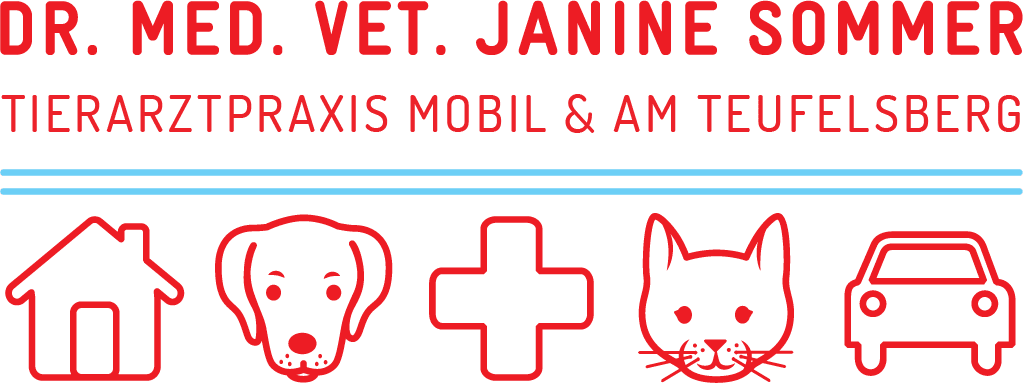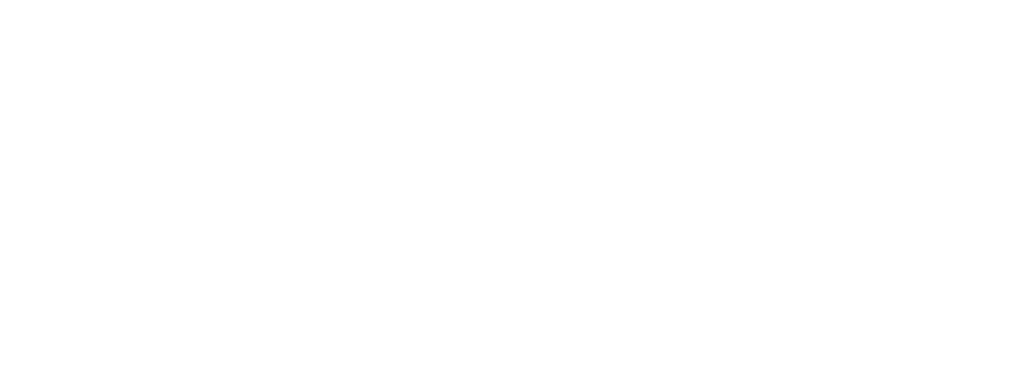Vor- und Nachteile der Kastrations-Varianten bei männlichen Tieren
Beide Varianten der Kastration weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Durch eine operative Kastration wird die Fortpflanzungsfähigkeit eines Tieres mit einem einmaligen Eingriff erreicht. Soll der Hund also dauerhaft an der Fortpflanzung gehindert werden, ist die operative Kastration kostengünstiger. Ist man sich unsicher, ob der Hund sein Verhalten durch eine Kastration ändern würde und deswegen unschlüssig, ist ein Chip als „Kastration auf Probe“ vorzuziehen. Dies gilt auch für Rüden mit einem unerwünscht hohen Sexualtrieb, die aber in Zukunft noch decken sollen. Bei Katern bietet sich eine chemische Kastration tatsächlich nur dann an, wenn das Tier in Zukunft aus bestimmten Gründen fortpflanzungsfähig sein soll. Ansonsten ist hier eine chirurgische Kastration zu empfehlen. Ihr Tier ist nicht mehr rollig und legt damit auch die typischen Merkmale dieses Zustandes, wie das Harnspritzen zur Duftmarkierung, ab.
Vor- und Nachteile der Kastration bei weiblichen Tieren
Jede Hündin ist einmalig und die Entscheidung zur Kastration sollte individuell besprochen werden. Durch die Kastration sinkt das Risiko für das Eintreten von gewissen Erkrankungen. Durch eine frühzeitige Durchführung (vor der ersten Läufigkeit) sinkt das Brustkrebsrisiko auf fast Null. Aber auch eine Kastration nach der ersten Läufigkeit vermindert das Risiko von Brustkrebs immer noch erheblich. Unabhängig vom Zeitpunkt der Kastration verhindert man eine möglicherweise auftretende Gebärmuttervereiterung (Pyometra). Vor allem bei älteren, unkastrierten Hündinnen besteht ansonsten ein hohes Risiko, an einer Pyometra zu erkranken. Auch die starken psychischen und physischen Symptome einer Scheinschwangerschaft / Scheinträchtigkeit bei Hündinnen können durch eine Kastration verhindert werden.
Während eine Kastration auf der einen Seite die Risiken gewisser Krankheiten senkt, steigert sie auf der anderen Seite leider das Auftreten anderer Krankheiten. Bei kastrierten Hündinnen steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Inkontinenz. Dies trifft vor allem auf größere Rassen zu. Diese Inkontinenz kann in den meisten Fällen erfolgreich behandelt werden. Die Wahrscheinlichkeit, an einem bösartigen Tumor der Milz, des Herzens (Hämangiosarkom) oder der Knochen zu erkranken, könnte eventuell erhöht sein. Weiterhin steigt das Risiko einer Schilddrüsenunterfunktion. Die Wahrscheinlichkeit für Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere Hüftdysplasie (HD), Patellaluxation und Kreuzbandrisse, steigt mit der Kastration ebenfalls. Allerdings ist das Eintreten solcher Krankheiten nach einer Kastration fast immer mit der Gewichtszunahme einzelner Tiere zu begründen. Kastrierte Tiere neigen vermehrt zu Übergewicht bzw. Fettleibigkeit. Die ausbleibende Produktion von Sexualhormonen senkt den Energiebedarf des Tieres, was von Seiten des Halters im Hinblick auf die Ernährung unbedingt beachtet werden sollte.
Bei Katzen dient die Kastration vor allem der Prävention einer ungewollten Trächtigkeit. Wenn Sie Ihr Tier frei herumlaufen lassen sinkt in dem Zusammenhang auch das Ansteckungsrisiko von geschlechtsspezifischen Krankheiten. Zudem fallen charakteristische Symptome der Rolligkeit Ihres Tieres weg. Ebenso kommt es nicht zur „Dauerrolligkeit“, welche durch bei unkastrierten Katzen bei nicht erfolgender Paarung eintreten kann. Dies würde permanenten Stress beim Tier und ein erhöhtes Erkrankungsrisiko der Geschlechtsorgane zur Folge haben. Die Lebenserwartung von kastrierten im Vergleich zur unkastrierten Tieren ist zudem durchschnittlich höher.
Letztlich bringt eine Kastration Ihrer Katze fast ausschließlich Vorteile mit sich. Die Ausnahme ist natürlich, wenn Sie Nachwuchs bei Ihrem Tier ausdrücklich wünschen. Zu beachten ist außerdem noch, dass der Eingriff bei weiblichen Tieren umfangreicher und auch teurer ist als bei den Männchen. Grund dafür ist die Lage der Geschlechtsorgane, welche einen rein äußerlichen Eingriff wie beim Männchen nicht zulässt. Vor allem bei älteren Tieren ist dies ein Faktor. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema individuell und besprechen mit Ihnen, was das Beste für Ihr Tier ist.
Das gilt es noch zu beachten – Vor- und Nachsorge bei der Kastration
Generell sollte eine Kastration nicht während der Läufigkeit / Rolligkeit durchgeführt werden. Im Idealfall sollte im Anöstrus (Sexualhormone inaktiv) kastriert werden. Zudem sollten Hündinnen niemals bei einer vorliegenden Vaginitis kastriert werden, da diese sonst persistiert. Bei Katzen empfiehlt sich eine Durchführung direkt mit eintretender Geschlechtsreife. Da sich diese schwer anhand äußerlicher Merkmale feststellen lässt, empfiehlt sich eine Kontrolle beim Tierarzt.
Sie können uns gerne im Vorhinein kontaktieren, damit gemeinsam der optimale Zeitpunkt für den Eingriff bei Ihrem Tier gefunden werden kann.
So läuft der Eingriff ab
- Das Tier sollte vor der Operation nüchtern sein, sprich 8 Stunden zuvor nichts mehr gefressen haben. Trinken ist allerdings ohne Einschränkung erlaubt.
- Am Tag der Kastration sollten Sie als Halter mit dem Tier zuhause bleiben, um es vor und nach dem Eingriff gut überwachen zu können.
- Der Eingriff dauert ca. 1,5h. Nach der Operation wird das Tier unter Kontrolle des Tierarztes oder der Tierarzthelferin aus der Narkose aufgeweckt.
- Trinken und Fressen sollten erst wieder angeboten werden, wenn das Tier wieder vollkommen wach ist, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht.
- Um sich vollumfänglich von den Strapazen des Eingriffes erholen zu können, braucht Ihr Tier ca. 10 Tage. Für Hunde heißt das, dass innerhalb dieser Zeit Spaziergänge angeleint und nur zum Verrichten der Notdurft unternommen werden sollten. In der Regel wollen die Tiere bereits vorher (nach ca. 4 Tagen) wieder voll belasten, woran sie unbedingt gehindert werden müssen.
- Auch das Schlecken an der Wunde soll in jedem Fall unterbunden werden. Durch das Überstreifen eines Bodys, das Auftragen von „Bitter Spray“ oder auch das Anlegen einer Halskrause kann dies gut verhindert werden.